Ein Buch, auf das ich mit einer gewissen Spannung gewartet habe, war es mir doch im Kreise meiner Bierkontakte schon mehrfach angekündigt worden. Die Schreibe des Autors, Uwe Ebbinghaus, ist mir aus seinen Artikeln, die er mehr oder weniger regelmäßig in der FAZ veröffentlicht, vertraut, und so habe ich mich gefreut, unlängst ein Rezensionsexemplar im Briefkasten vorzufinden.
Disclaimer: Davon, dass es sich um ein Gratis-Rezensionsexemplar handelt, habe ich mich in meinem folgenden Text nicht beeinflussen lassen. Glaube ich jedenfalls.
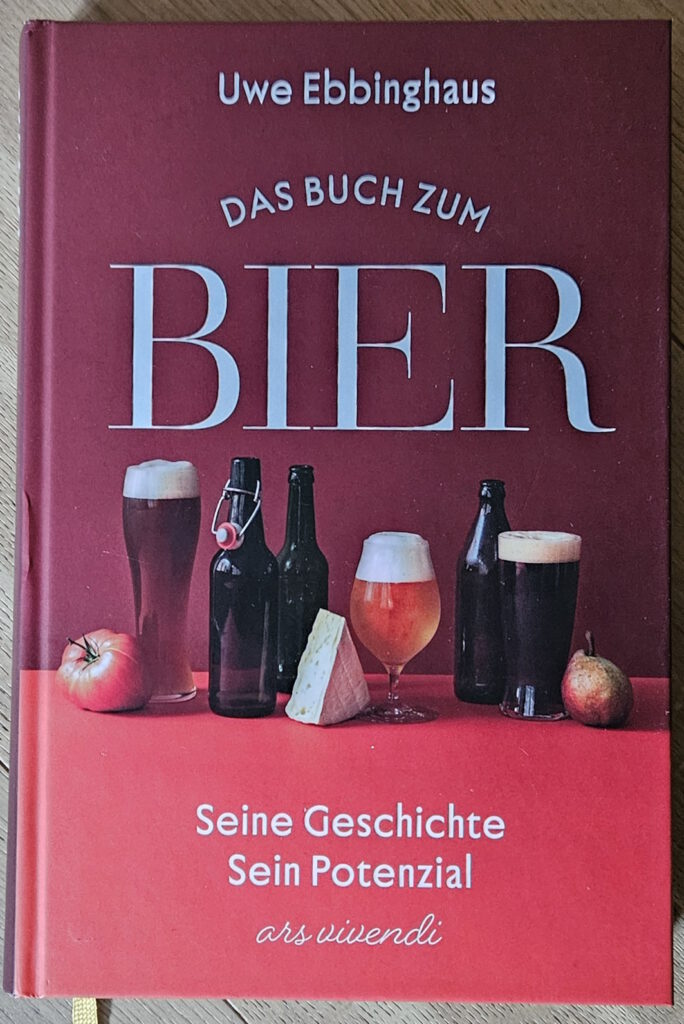
Uwe Ebbinghaus:
Das Buch zum Bier.
Seine Geschichte. Sein Potenzial.
Der Titel verspricht viel: Sowohl die Geschichte als auch das Potenzial des Biers in einem Band abhandeln zu wollen, zeugt von Ehrgeiz, Ehrgeiz, der sich in insgesamt elf sehr flüssig geschriebenen Kapiteln plus Vorwort, Nachwort, Glossar, Anhang und einem zwölften, eher aufzählungshaften Kapitel widerspiegelt.
Die Reihenfolge der Themen erscheint ein bisschen willkürlich – von Bamberg geht es zur Geschichte, von dort zum Craftbier, dann in die Städte Düsseldorf, Köln und Einbeck. Ein Abstecher nach Hamburg folgt, dann kommt das Thema „Das Bier und die Dichter“. Es folgen Bayern und München (nein, nicht Bayern München – die Kapitelüberschrift setzt bedacht einen Gedankenstrich zwischen die beiden Substantive), Berlin, Tschechien und Belgien. Wobei es zwischen Tschechien und Belgien noch einen Ausflug in den Bieralltag gibt. Das zwölfte Kapitel handelt vom Foodpairing, also von der Kombination von Bieren und dazu passenden Speisen und ist eher in Form einer Liste gestaltet.
Viel Lesestoff. Unterhaltsamer Lesestoff. Flüssig und flott geschrieben, sich nicht zu sehr in Details zu vertiefen, die Otto Normalbiertrinker überhaupt nicht interessieren, aber auch nicht so oberflächlich, dass der mit allen Wassern Bieren gewaschene Bierliebhaber am Beginn eines Absatzes immer schon wissen würde, was jetzt an Informationen und abgedroschenen Metaphern und Gags kommt …
Ebbinghaus hat sich andere Autoren zur Unterstützung geholt und fügt in seine Texte immer wieder Bausteine von ihnen ein: Hans Wächtler, Sebastian Sauer, Jaroslav Rudiš, Frank Geeraers und Filip Nerad mögen der einen oder anderen meiner Leserinnen schon vertraut sein. Schade, dass nicht immer eindeutig erkennbar ist, welche Absätze aus welcher Feder stammen – manchmal merkt man es als aufmerksamer Leser nur am Stil, dass bestimmte Abschnitte nicht von Ebbinghaus, sondern einem der anderen Autoren stammen. Meistens ist es aber gekennzeichnet.
Mir hat die Lektüre gefallen, in nur wenigen Tagen habe ich mich von vorne nach hinten durch das Buch geschmökert und einiges Neues über Bier gelernt. Und gefreut habe ich mich – über ein sehr sorgfältiges Lektorat, das nahezu keinen Fehler hat durchgehen lassen. Natürlich kann man sich über Formulierungen wie „heilige Mönche“ (Seite 7) amüsieren und sich fragen, ob es auch unheilige Mönche gibt, und ebenso geht es mir persönlich immer quer runter, wenn Bier abwertend als „Gerstensaft“ bezeichnet wird (Seite 9), ein Ausdruck, der eigentlich nur bei unreflektierten Volumentrinkern in Gebrauch ist.
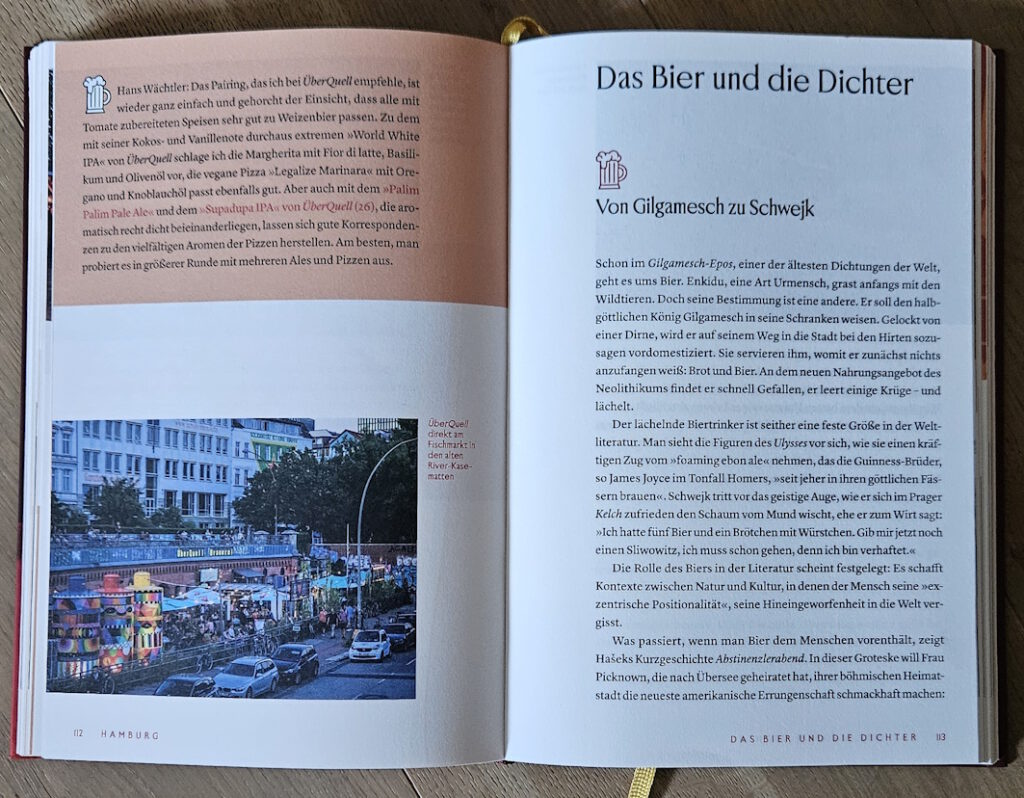
klare Gliederung, bunte Bilder, gute Texte
Aber der einzige echte Lapsus, den ich gefunden habe, ist, dass das Bier „Kiez Keule“ von BrewDog aus Berlin gleich zu zwei unterschiedlichen Stilen als Referenz herhalten soll – einerseits als Beispiel für ein gelungenes Export / Dortmunder (Seite 233), andererseits als Empfehlung für ein Kellerbier / Zwick(e)l / Zoigl / Kräusen (Seite 234). Eigentlich geht nur eines von beidem …
Wobei zu eben dieser Seite, der Seite 234, natürlich auch noch die Frage gestellt werden darf, ob der Zoigl in die Aufzählung hinein gehört oder nicht. Kellerbiere, Kräusen oder Zwick(e)lbiere sind ungefilterte Lagerbiere, egal, wo sie herkommen, klar. Aber Zoigl ist eigentlich die Bezeichnung für ein Bier, dass unter historisch gewachsenem Kommunbraurecht in einem Kommunbrauhaus eingebraut und daheim im Keller vergoren und gelagert wird, bis es schließlich eben dort, nämlich „daheim“, gegen geringes Entgelt ausgeschenkt wird. Dass der Zoigl dabei ebenfalls unfiltriert bleibt, liegt in der Natur der Sache, macht ihn aber nicht automatisch zu einem Keller-, Kräusen- oder Zwick(e)l-Bier. Umgekehrt geht das auch nicht – nicht jedes unfiltrierte Lagerbier wird zu einem Zoigl. Aber hier ist nicht unbedingt der Autor schuld – vielmehr haben sich leider die Kategorien wegen eines verschnarchten Markenschutzes zu Gunsten primitiven Marketings verschoben. Zu schade, dass die Zoiglbrauer erst viel zu spät aufgewacht sind und sich dann nur noch den Begriff Echter Zoigl vom Kommunbrauer haben schützen lassen können.
Tja, und was mir persönlich noch gefehlt hat, ist ein Kapitel über die Bierkultur Englands. Die ist irgendwie hinten runter gefallen. Schade.
Sei’s drum.
Das Buch ist trotzdem prima, es ist mit zweiundzwanzig Euro nicht übermäßig teuer, es ist schön gebunden, und es hat sogar ein Bändchen als Lesezeichen, ein Service, den man viel zu selten noch antrifft.
Daher: Eine Leseempfehlung meinerseits!
Uwe Ebbinghaus
Das Buch zum Bier
Seine Geschichte. Sein Potenzial.
ars vivendi Verlag GmbH & Co. KG
Cadolzburg, 2024
ISBN 978-3-7472-0530-3

Hinterlasse jetzt einen Kommentar