„Ich mag kein Bier, das ist mir zu bitter.“ Wer von uns hat diese Aussage nicht schon mal gehört?
Bei mir verursachen diese Worte immer ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits antworte ich fast schon im Reflex: „Ach, es gibt doch auch milde Biere mit ganz wenig Bittere, probier die doch mal!“ Andererseits wundere ich mich aber auch, woher die zunehmende Abneigung gegen Bittere eigentlich herkommt, und finde die Entwicklung schade. Bittere ist nämlich ein sogenannter „acquired taste“, ein Geschmack, an den man sich gewöhnen muss, bevor man ihn wertschätzt, und anscheinend mögen sich immer weniger Menschen diesem Gewöhnungsprozess aussetzen.
Früher hatte ein klassisches, deutsches Pils weit über dreißig, manchmal über vierzig Bittereinheiten1, aber in den letzten beiden Jahrzehnten ist bei fast allen Pilsmarken die Bittere heruntergegangen, teilweise auf unter zwanzig. Da muss man schon ganz genau hinschmecken, um die Bittere noch zu spüren.
Gleichzeitig wird das Helle immer beliebter – ein Bier, bei dem die Bittereinheiten manchmal bis in den einstelligen Bereich hinuntergehen. Süßliche, ganz milde Biere sind das, und sie verkaufen sich von Jahr zu Jahr besser.
Je öfter wir diese milden Biere trinken, desto weniger sind wir die Bittere gewohnt, werden also von bitteren Bieren abgeschreckt. Die Brauereien reagieren darauf und bieten ihrerseits immer mildere Biere an. Ein sich wechselseitig verstärkender Effekt?
Werden irgendwann einmal Biere in Mode kommen, die überhaupt keine wahrnehmbare Bittere mehr haben? Bei denen, scherzhaft gesagt, der Brauer den Hopfen feierlich auf einem Samtkissen um den Sudkessel herumträgt, ihn aber gar nicht mehr in den Sud wirft? Die Hopfenbauern fürchten ein solches Szenario.
Die Welle der heftigen und manchmal bis an die Schmerzschwelle gehopften India Pale Ales mit Bittereinheiten bis zu hundert schien vor ein paar Jahren diese Entwicklung zeitweilig umzudrehen, aber diese Mode ebbt bereits wieder ab. Vielleicht war sie ein bisschen testosterongetrieben, von Heranwachsenden, die ihre Männlichkeit damit beweisen mussten? Mittlerweile sind diese Hopfenbomben seltener geworden.
In unserem Nachbarland Tschechien versuchen die Hopfenbauern erfolgreich, ihr Grünes Gold und dessen Bittere wieder als Genuss darzustellen, und eine größere Brauerei wirbt in ihrem Brauereiausschank humorig mit dem Claim „Život je hořký. Bohudík.“ – „Das Leben ist bitter. Zum Glück.“
Ob sich auch bei uns der Trend wieder zu kräftig gehopften Bieren drehen wird? Ich persönlich würde es begrüßen – Ihr auch?
1 Was eine Bittereinheit ist, spielt hier gar keine so große Rolle, es geht eher um den Zahlenvergleich, aber wer es genau wissen will: Eine Bittereinheit entspricht einem Milligramm gelöster Iso-Alphasäuren (das sind die Bitterstoffe des Hopfens) auf einen Liter Bier. Ab etwa 100 Bittereinheiten ist unsere Zunge „gesättigt“, das heißt, bei noch höheren Werten schmecken wir keinen Unterschied mehr.
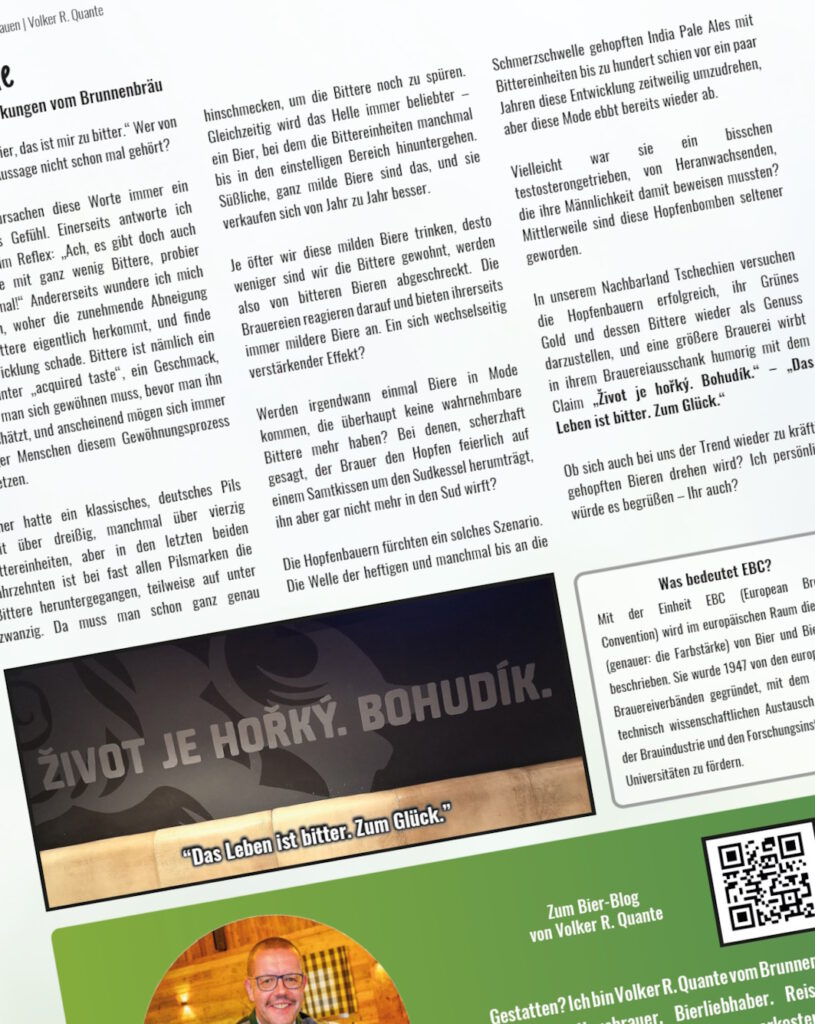
Dieser Text ist im Juli 2023 im Kundenmagazin „Brauerlebnis – Das Magazin für Hobbybrauer“ von Hopfen und mehr erschienen.

Nichts von seiner Aktualität verloren. Hier natürlich auf Bier bezogen, muss man das Thema im Gesamtkontext sehen. Es zeigt sich in allen Branchen. Lebensmittel insgesamt werden süßer, der Zuckerkonsum steigt an. Durch neue Züchtungen sinken die Bitterstoffanteile im Gemüse (Glucosinolate im Rosenkohl, um nur ein Beispiel zu nennen). Auch bei einem IPA ist das Bittere ja eher notwendige Begleiterscheinung zum allseits beliebten Aromen der Hopfenöle. Insoweit ist nachvollziehbar, aber natürlich schade, dass sich anscheinend sich immer weniger Menschen diesem Gewöhnungsprozess aussetzen. Umso mehr bin ich allen Brauereien dankbar, die noch Pilsbiere mit 40 IBU und mehr brauen.
Danke für Deinen ausführlichen Kommentar, Chris.
Ja, viele bittere Pilsener gibt es nicht mehr … Am angenehmsten in seiner ausgeprägten und dennoch harmonischen Bittere finde ich das Riegele Herren Pils aus Augsburg – aber selbst das ist einigen Bierkennern in meinem Bekanntenkreis schon zu viel …
Mit bestem Gruß,
VQ